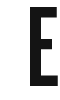
in Reiseheft zu Sardinien für National Geographic Traveler. Ich war mit dem Fotografen Gulliver Theis unterwegs im Supramonte-Gebirge und auf dem Küstenwanderweg Selvaggio Blu, bin zu den Dünen von Piscinas geritten, habe den Sternekoch Roberto Petza in seinem Restaurant auf dem Land besucht und bin mit Skipper Stefano Caria durch das türkisfarbene Wasser des Maddalena-Archipels gesegelt. Hier meine Reportage aus dem Supramonte-Gebirge und vom Selvaggio Blu:
Über einen Geröllhang klettern wir in die karge Kalksteinwelt des Supramonte. Der Morgennebel hat sich verzogen, ein blauer Himmel spannt sich über uns. Wir laufen unter den Kronen uralter Steineichen hindurch, die aussehen, als hätte sie jemand mit einer Heckenschere getrimmt. „Die Ziegen fressen hier alles ab, was sie erreichen können“, sagt unser Wanderführer Luciano Murgia, ein hoch gewachsener Mann. Er geht mit großen Schritten bergauf. Wir folgen ihm auf alten Hirtenwegen durch das von Schluchten zerfressene Kalksteingebirge im Osten Sardiniens.
Murgia kennt diese Berge von Kindesbeinen an, oft hat er seinen Vater begleitet, der hier schon mit zwölf Jahren tagelang alleine Ziegen hüten musste. „Das waren harte Zeiten. Alle meine Vorfahren haben so gelebt, und im Herzen bin auch ich noch ein Hirte“, sagt Murgia. Bald darauf passieren wir eine Wegmarkierung der Tierhüter: einen weißen Stein in einer Astgabel.
Lange war Sardinien vor allem als Strandziel bekannt, das dünn besiedelte Hinterland bot kaum Anlaufpunkte, und es gab nur wenige offizielle Wanderwege. Seit einigen Jahren ändert sich das, der Wandertourismus auf der Insel nimmt zu, neue Routen entstehen. Doch noch immer führen vielerorts nur Hirtenpfade durch die weitgehend unentdeckte Bergwelt. Am besten man erkundet sie mit Einheimischen wie Luciano Murgia.
Wir erreichen einen schmalen Grat, auf dem Heiligenkraut und Wolfsmilch wachsen. Tote, windschiefe Wacholderbäume säumen den Hang, ihre silbern schimmernden Äste sind kunstvoll gewunden. Vor uns tut sich eine weite Hochebene auf. Ein dichter Eichenwald erstreckt sich bis zu fernen Kalksteingipfeln, auf halbem Wege versinkt er in einer gewaltigen Schlucht. Hinter uns erstreckt sich strahlendblau das Mittelmeer.
Von einem Felsvorsprung schauen wir hunderte Meter in die Tiefe auf ein ausgetrocknetes Flussbett. Turmfalken segeln vor der steilen Wand. „Wir nennen sie futientu, was auf Sardisch Dieb des Windes heißt“, sagt Murgia. Wie viele Sarden ist er mit dieser Sprache aufgewachsen, die sich aus der lateinischen Umgangssprache heraus entwickelt hat und bis heute wichtiger Bestandteil der sardischen Identität ist. „Sardinien ist nicht Italien“, sagt er. „Die Italiener verstehen uns nicht, wenn wir untereinander sprechen.“
Murgia führt uns vom Grat hinunter in den Eichenwald und zu einer Lichtung, auf der eine verlassene Hirtenhütte steht: ein fantastisches Gebilde aus verwitterten Wacholderstämmen in Form eines Tipis. Wir heben die schweren Bretter vor dem Eingang beiseite, ein süßlicher Wacholderduft strömt uns entgegen. Eine quadratische Feuerstelle ist in den Boden eingelassen, darüber hängt ein hölzernes Gestell, auf dem früher der Käse lagerte. „Bis vor gut 30 Jahren lebte hier noch ein alter Mann mit seinen Tieren“, sagt Murgia.
Auf einer Anhöhe sehen wir die Reste eines Rundturms aus dicken Steinblöcken. Mehr als 3000 solcher „Nuraghen“ gibt es auf Sardinien. Sie bildeten ein Netz von Wehrtürmen, das die ganze Insel überspannte und wurden vor rund 3500 Jahren von einem Volk erbaut, von dem nur wenig überliefert ist. Auf Wanderungen begegnet man auch ihren monumentalen Grabanlagen, etwa den „Gigantengräbern“ von S’Arena auf einem Plateau des Supramonte, deren geschwungene Form an die Hörner eines Stiergottes erinnert.
Die Nacht verbringen wir in einer alten Hirtenhütte. Bustiano Cabras hat sie für seine Gäste renoviert. Er röstet ein Spanferkel am Feuer, serviert als Vorspeise würzig-scharfen Caprino-Käse, den er aus der Milch seiner Ziegen macht, dazu Schinken, Oliven und dünne Scheiben knusprigen Hirtenbrots mit Olivenöl. Es gibt sardischen Cannonau-Rotwein. Cabras erzählt von seinen Vorfahren, die wie er Hirten waren – aber auch Banditen. Im 19. Jahrhundert ritten sie von den Bergen in die Städte, um von den Reichen zu stehlen. „Die Menschen im Supramonte waren bettelarm, sie mussten Steuern bezahlen, erhielten aber keinerlei Hilfe“, sagt er. „Für die Regierung war es fast unmöglich, die Banden hier oben zu fassen.“ Einige Räubergeschichten später liegen wir im Schlafsack in der Hütte. Ein Feuer flackert, die Schatten tanzen an der Wand aus Wacholderholz.
Am Morgen wandern wir zur Gorropu-Schlucht, die eine der tiefsten Europas ist. Durch ein trockenes Flusstal folgen wir der aufgehenden Sonne bis zu ihrem Eingang, wo Felsbrocken verstreut liegen, als hätten Riesen mit ihnen gewürfelt. Wir klettern über sie herüber und um sie herum. Die Kalksteinwände wölben sich zu bedrohlichen Überhängen, formen Grotten, Spalten und Vorsprünge, auf denen zartgrüne Pflänzchen wachsen: eine seltene Akeleienart, die nur hier vorkommt. Dann verengt sich der Fels zu einer engen Klamm, die Wände ragen zu beiden Seiten 500 Meter steil in die Höhe. Der Himmel ist nur noch als schmales blaues Band zu erkennen.
Keine 15 Kilometer östlich der Gorropu-Schlucht endet das Kalksteinmassiv des Supramonte jäh am Meer und bildet über viele Kilometer eine schroffe Steilküste. Hier verläuft ein spektakulärer neuer Küstenwanderweg, der Selvaggio Blu. Sechs Tage braucht man, um die rund 50 Kilometer von Pedra Longa bis Cala Sisine auf alten Hirtenwegen und querfeldein zu laufen, unterwegs muss man an vielen Stellen klettern und sich abseilen. Der Selvaggio Blu gilt als eine der härtesten Trekkingrouten Italiens, doch mit guten Kletterführern ist er auch für weniger Geübte gut zu schaffen. Wir werden die letzte Teiletappe auf ihm wandern.
Ein Boot bringt uns am Nachmittag zur Grotta del Fico: eine Tropfsteinhöhle, deren Eingang in einer Klippe über dem Golf von Orosei liegt. Tausende Tropfsteine hängen von der Decke und wachsen aus dem Boden, manche dünn wie Eiszapfen, andere dick und wulstig, glatt und transparent oder pockig und rau wie ein Blumenkohl. Ein fantastisches Kunstwerk der Natur.
Draußen, auf einer Holzterrasse über dem Meer, stellt uns Mario Muggiano selbstgemachten Pecorino, Oliven, Schinken und gegrilltes Kalbsfleisch auf den Tisch. Der Hirte und leidenschaftliche Hobby-Höhlenforscher hat die Grotta del Fico vor 13 Jahren mit einigen Freunden zugänglich gemacht, Stege gebaut und die Beleuchtung angebracht. Wanderer können vom Selvaggio Blu einen Abstecher machen und hier übernachten.
Am nächsten Morgen hängen wir an einem Drahtseil und suchen nach kleinen Tritten und Griffen im Fels. Die Kletterpassage ist der einzige Weg von der Grotta del Fico zurück auf den Selvaggio Blu. Unter uns tost das Meer. Durch eine dunkle Höhle kriechen wir auf eine Felsgalerie – und vor uns liegt die wilde Küste des Selvaggio Blu mit ihren bewaldeten Hängen und hohen Kalksteinklippen. Nicola Collu und Manuela Tegas zeigen uns den Weg. Sie sind am Morgen mit dem Boot zur Grotte gekommen und haben uns unser Klettergeschirr mitgebracht. Beide sind als Wanderführer die ganze Saison über auf dem Selvaggio Blu unterwegs. Schon ihre Großväter kletterten hier umher, um nach ausgebüxten Ziegen zu suchen.
Stundenlang laufen wir über schmale Felsgrate, durch Eichenhaine und entlang grauer und ockerfarbener Steilwände. Wir kämpfen uns durch loses Gestein und klettern – an Drahtseilen gesichert – steile Hänge hinauf. Es ist eine beeindruckend urwüchsige Landschaft am Rande des Meeres. Verkrüppelte Wacholderbäume strecken uns ihre Äste entgegen. Menschen treffen wir keine, hören nur hin und wieder die Brunftrufe verwilderter Ziegenböcke.
Dann müssen wir uns abseilen, um eine 20 Meter hohe Steilwand zu überwinden. Nicola Collu bindet das Seil an einem Wacholderbaum fest, sichert es mit zwei Karabinern und lässt es langsam durch die Hände gleiten. „Einfach mit dem Rücken zum Abgrund stellen und mit vollem Gewicht in den Klettergurt lehnen“, sagt er. Ich spreize die Beine, suche mit den Füßen nach Halt – irgendwie geht es. Die nächste Wand ist noch 20 Meter höher, aber auch das Vertrauen größer. Bald macht sogar der Blick in den Abgrund Spaß.
Erschöpft erreichen wir am späten Nachmittag Cala Sisine, einen breiten weißen Strand, der das Ende des Selvaggio Blu markiert. Ein letztes Mal seilen wir uns ab. Dann laufen wir über den Sand und stürzen uns kopfüber in das türkisblaue Wasser.
KontaktMirco Lomoth | Textetage | Mariannenstraße 9 — 10, 4. Stock | 10999-Berlin
Impressum und Datenschutzerklärung
Die Internetseiten von Mirco Lomoth verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden.
Webgestaltung & Umsetzung: Irvandy Syafruddin | Mirco Lomoth © 2018
